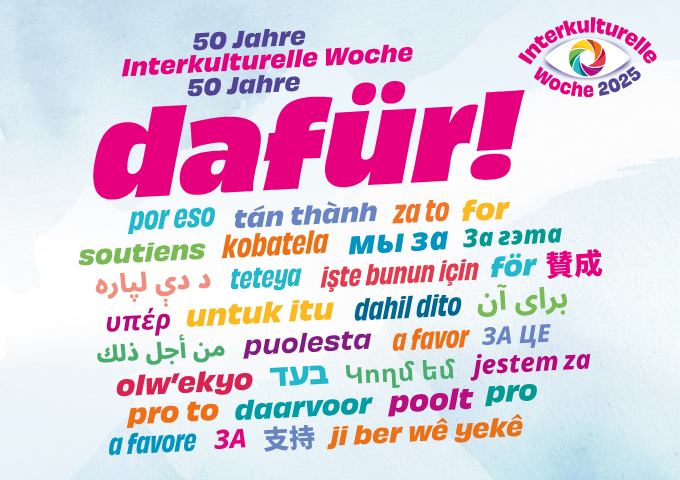DAFÜR!
Vor 50 Jahren, im Jahr 1975, initiierten die Deutsche Bischofskonferenz, die Evangelische Kirche in Deutschland und die Griechisch-Orthodoxe Metropolie von Deutschland die Interkulturelle Woche. In fünf Jahrzehnten hat sich die Initiative etabliert und ist als großes und vielfältiges Netzwerk der Zivilgesellschaft fest verankert. Das Jubiläum gibt uns Anlass zum Feiern und zur Dankbarkeit, aber auch Gelegenheit zu einer Standortbestimmung und einer Besinnung auf das zentrale Anliegen, das wir mit der Initiative verbinden. Das diesjährige Motto, das aus einem einzigen Wort und einem Ausrufezeichen besteht, beinhaltet eine solche kraftvolle Standortbestimmung: DAFÜR! Auf größer werdende Vorbehalte und Ängste, auf zunehmende Ausgrenzung, offenen Rassismus und die Zurückweisung von Menschen mit Migrationsgeschichte antwortet die Interkulturelle Woche mit einem klaren Statement:
Wir sind DAFÜR – für jeden einzelnen Menschen!
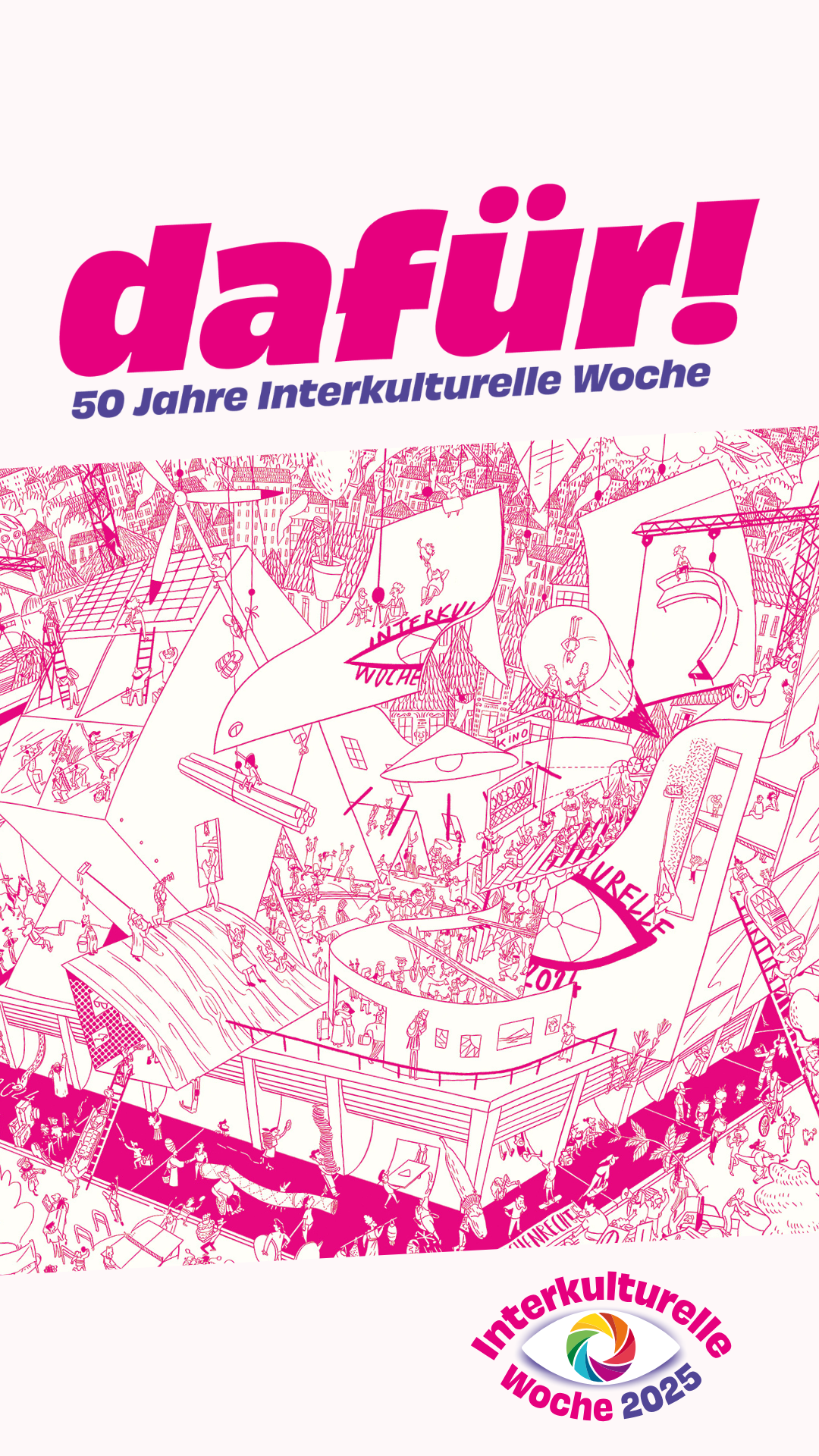
Denn das ist unsere Basis: Gottes uneingeschränktes Ja zu jedem einzelnen Menschen. Nach Gottes Ebenbild sind wir geschaffen (Genesis 1,27), in aller Einzigartigkeit und zugleich in aller Vielfalt. Dieses Ja Gottes zu den Menschen wird dadurch unmittelbar greifbar, dass Gott selbst Mensch wird i
n der Person Jesu Christi. Und der menschgewordene Gott Jesus Christus ist sogar bereit, aus Liebe zu den Menschen in den Tod zu gehen. Seine Auferstehung ist für uns das stärkste Signal gegen alle Todeserfahrungen: Gott will, dass wir leben! Sein bedingungsloses Ja ist die Grundlage des christlichen Menschenbildes und fordert uns zu einem ebensolchen Ja unseren Mitmenschen gegenüber auf. "Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben" (Johannes 13,34), so appelliert Jesus Christus an uns alle.
Natürlich ist nicht alles gut, was Menschen tun, was Menschen sagen, denken und wollen. Und dennoch ist jeder Mensch, unabhängig davon, was er tut und was er sagt, aber auch unabhängig davon, was er kann, was er besitzt, wie alt er ist und wo er geboren ist, unendlich wertvoll, unbezahlbar und unverzichtbar. Weil jeder Mensch ein Lieblingsgedanke, eine Schöpfung und ein Lieblingskind Gottes ist, sagen wir Ja zu jedem Menschen. Darin besteht unsere grundlegende Motivation, uns als Kirchen mit der Interkulturellen Woche für einen respektvollen, wertschätzenden Stil des Miteinanders in unserer Gesellschaft einzusetzen. Deshalb werden wir dort, wo Menschen verächtlich gemacht und ausgegrenzt, angegriffen und verfolgt werden, ihre Würde und ihre Rechte verteidigen.
DAFÜR gibt es die Interkulturelle Woche nun schon seit 50 Jahren.
Die Initiative hieß zunächst "Tag des ausländischen Mitbürgers". Was heute veraltet klingt, war in den 1970er Jahren ein gesellschaftspolitisches Statement, das deutlich machte, dass die in Deutschland lebenden Migrantinnen und Migranten mehr waren als "Gastarbeiter", die in Deutschland ihre Arbeit erledigten, danach wieder zurück in ihre Heimat gingen und im Übrigen nicht viel mit unserem Land zu tun hatten. Es sollte zum Ausdruck gebracht werden, dass es sich um Menschen handelte, die zwar aufgrund ihrer Arbeit nach Deutschland gekommen waren, nun aber mit ihren Familien dauerhaft hier lebten und Teil der Gesellschaft geworden waren.
Schon 1978 sprachen die Kirchen deshalb in ihrem Gemeinsamen Wort von Deutschland als einem "Einwanderungsland". 1980 formulierte der Ökumenische Vorbereitungsausschuss: "Wir leben in der Bundesrepublik in einer multikulturellen Gesellschaft", und ab 1991 wurde die Bezeichnung "Interkulturelle Woche" eingeführt. Wir sind überzeugt davon, dass die in vielerlei Hinsicht so unterschiedlichen Menschen und Gruppen nicht nur ihren Platz in unserer Gesellschaft haben, sondern dass wir alle gegenseitig voneinander lernen können und insgesamt als Gesellschaft von solcher Vielfalt profitieren.
DAFÜR brauchen wir eine starke Demokratie.
Um die Rechte jedes einzelnen Menschen schützen und eine gerechte Ordnung gewährleisten zu können, brauchen wir unsere freiheitliche Demokratie und eine funktionierende demokratische Kultur. Zu einer solchen demokratischen Kultur gehören unterschiedliche Interessen und Positionen ebenso wie der Streit um die besseren Lösungen und Entscheidungen. Aus biblisch-christlicher Perspektive verwirklicht sich Gerechtigkeit allerdings "in einem einander stützenden Miteinander, nicht in einem taxierenden Gegeneinander"1 . Die Auseinandersetzung in der Sache darf nie zu Hass führen, sondern muss immer im gegenseitigen Respekt ausgetragen werden. Nie darf die menschliche Würde der Andersdenkenden verletzt werden, auch wenn ihre Positionen gemäß der eigenen Überzeugung noch so falsch sind. Wir dürfen nicht müde werden, für unsere Demokratie zu kämpfen und immer wieder Brücken zu bauen von Mensch zu Mensch.
DAFÜR gibt es das Grundrecht auf Asyl, das in keiner Weise ausgehöhlt werden darf.

Es darf keinen Zweifel daran geben, dass Menschen, die in ihren Herkunftsländern politisch verfolgt werden und Schutz suchen, in Deutschland ihr Recht auf Asyl geltend machen können. Ebenso bedeutsam ist der Schutz von Menschen, die aus Gewaltsituationen wie Kriegen und Bürgerkriegen zu uns fliehen. "Auf jeder Seite aller möglichen (politischen) Grenzen befinden sich Menschen. Keine wie auch immer geartete Grenze legitimiert die Missachtung der Menschenwürde und die Verweigerung von elementarem Schutz angesichts akuter Gefährdung."2 Die Aufnahme geflüchteter Menschen hat unsere Gesellschaft immer wieder auch herausgefordert. Solchen Herausforderungen gilt es politisch zu begegnen. Länder und Kommunen müssen durch entsprechende Regelungen und Ressourcen in die Lage versetzt werden, ihren Verpflichtungen bei der Aufnahme geflüchteter Menschen nachzukommen und dabei zugleich die Sicherheit und Ordnung im Land zu gewährleisten. Aber es kann niemals eine Option sein, Menschen in existenziellen Notlagen abzuweisen oder auch zu verhindern, dass Menschen mit ihren Familienangehörigen zusammenleben.
DAFÜR lohnt sich der Einsatz im Rahmen der Interkulturellen Woche.
Die interkulturelle Woche entfaltet ihre gesellschaftliche Kraft durch den persönlichen Einsatz Tausender Aktiver, die mit großem Engagement und unermüdlicher Kleinarbeit unzählige Einzelveranstaltungen und Initiativen in derzeit rund 750 Städten und Gemeinden organisieren. Die Veranstaltungen und Programme werden von lokalen Bündnissen verantwortet, in denen sich Kirchengemeinden, Kommunen, Selbstorganisationen von Migrantinnen und Migranten, Wohlfahrtsverbände, Gewerkschaften, Bildungseinrichtungen und engagierte Einzelpersonen zusammentun. Ihnen allen – und insbesondere denen, die aufgrund ihres Engagements inzwischen selbst angefeindet werden – möchten wir unseren großen Dank und tiefen Respekt ausdrücken. Denn sie leisten einen unverzichtbaren und nicht zu überschätzenden Dienst an unserer Gesellschaft, einen Dienst an der Demokratie, einen Dienst an allen Menschen und ihrer Würde.
1 Evangelische Kirche in Deutschland/Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.): Migration menschenwürdig gestalten. Gemeinsames Wort der Deutschen Bischofskonferenz und des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland. Gemeinsame Texte Nr. 27 (Hannover/Bonn 2021), S. 109.
2 Ebd., S. 104.